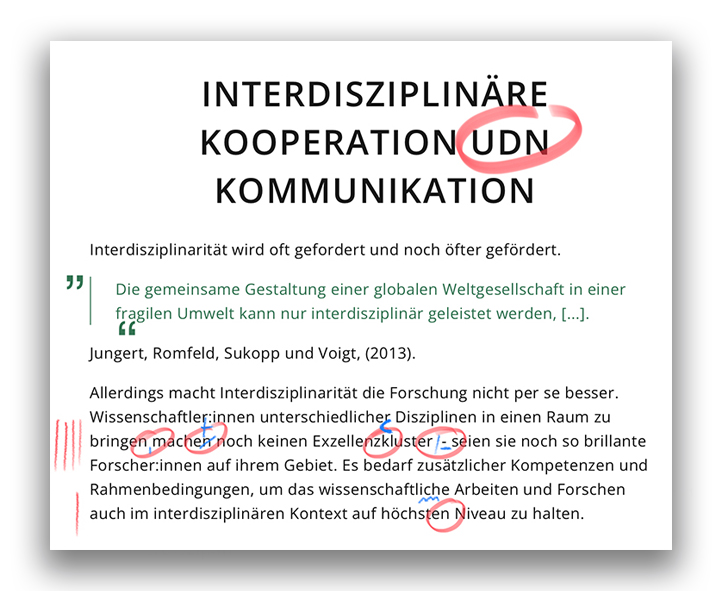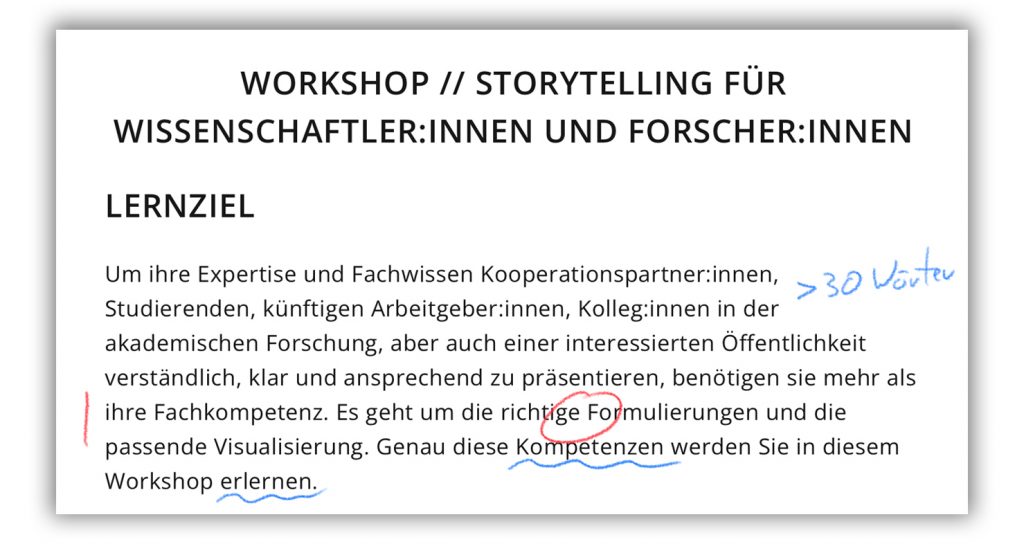Im Beruf ist es wie in der Liebe: Den passenden Partner oder die passende Partnerin zu finden, ist gar nicht so einfach. Selbst wenn es nur für eine kurze Zeit ist, die man miteinander verbringt – z. B. für ein Publikationsprojekt, einen Workshop oder eine strategische Beratung. Für ein langes Kennenlernen ist keine Zeit. Die wenigsten Kooperationen starten mit einem Candlelight-Dinner oder einer mehrmonatigen Schnupper-Phase mit Händchenhalten. Die Auswahl erfolgt meist in Form eines Speed-Datings: Kurzer Blick auf die Website, kurzer Blick aufs Angebot (oft zählt nur der Preis) und schwupps, schon ist man liiert.
Doch wie im richtigen Leben kann auch das ganz schön teuer werden und im Zweifel mit einer schmerzhaften Trennung enden. Es sind vor allem die ersten Meter, die über Erfolg oder Nicht-Erfolg einer professionellen Zusammenarbeit entscheiden. Wer bei der Vorauswahl möglicher Projektpartner*innen nicht genau hinschaut, den kostet das später mitunter viel Zeit, Ärger und Geld. Besonders die berufliche Selbstdarstellung von Kreativen und Freiberufler*innen birgt einige Fallstricke. Sie ist nämlich erst mal nur eine Selbstdarstellung. Und die gilt es sorgfältig zu prüfen.
Leidenschaft, die Leiden schafft
„Schon in meiner Jugend habe ich viel gelesen und war Schreiben eine meiner größten Leidenschaften. Beides hat mich mein Leben lang begleitet. Nach 15 Jahren Sachbearbeiter-Tätigkeit in einem Versicherungskonzern habe ich mich entschieden, diese Leidenschaft zu meinem Beruf zu machen und meine Kunden davon profitieren zu lassen.“ [Originalauszug aus einem Freiberufler-Portrait]
Stellen Sie sich vor, Ihr Institut oder Ihre Stiftung bräuchte eine neue, maßgeschneiderte IT-Umgebung. Diese müsste von externen Projektpartner*innen entwickelt und implementiert werden. Im günstigsten Angebot, dass sie eingeholt haben, steht: „Ich habe mich schon in jungen Jahren für Technik begeistert und für Freunde und Bekannte erste eigene Skripte geschrieben. Ausbildung und Beruf haben mich zunächst in eine andere Richtung geführt, doch nach zehn Jahren als Verkaufsleiter im Modehaus Möller setze ich nun meine Leidenschaft für Computer beruflich um und entwickle professionelle Software-Lösungen für Unternehmen.“
Gibt`s nicht? Oh doch! Und zwar häufiger als Sie denken. Und natürlich (bzw. hoffentlich) wird das nicht der Partner, mit dem Sie in den nächsten Monaten Ihre neue IT-Lösung entwickeln. Sie wollen ja auch keinen Konflikt-Coach, der zu seinem Beruf fand, weil er „schon immer gut mit Menschen konnte“ oder eine Veranstaltungsmanagerin, deren Haupttrumpf darin liegt, dass sie „leidenschaftlich gerne Feste organisiert und sich auch vor größeren Herausforderungen nicht scheut“ – wie z. B. die 150-Jahrfeier ihrer Stiftung mit 600 Gästen.
Keine Frage, Leidenschaft und Begeisterung sind eine tolle Sache, auch im Beruf. Aber es sind keine fachlichen Kompetenzen. Sie sagen nichts über den professionellen Hintergrund und die beruflichen Fähigkeiten aus. Außerdem sollte man bei Freiberufler*innen davon ausgehen können, dass sie sich einen Beruf gesucht haben, den sie auch leidenschaftlich gerne machen. Das gilt besonders für Kreative wie Autor*innen, Grafiker*innen, Gestalter*innen, Fotograf*innen usw. Und bei aller Begeisterung für persönliche Begeisterung: Vor der professionellen Umsetzung sollte stets das Können stehen.
Zu viel Leidenschaft und Herzblut sind auch gar nicht so gut, weder für die gemeinsame Projektarbeit noch für das Projekt bzw. Vorhaben selbst. Gerade Kreative müssen darauf achten, eine fachlich-professionelle Distanz zur eigenen Arbeit zu wahren. Die Frage ist, was dient dem Projekt bzw. den Zielen der Auftraggeber*innen und nicht: „Woran hängt mein Herz?“ Im Rahmen eines Kreativprozesses entsteht so manches, was einer Autorin oder einem Grafiker lieb und teuer ist. Davon müssen sie sich im Zweifel trennen können und das emotionslos. Kill your Darlings heißt die nicht ganz so leichte Aufgabe, mit der auch ich als Autor regelmäßig konfrontiert werde. Doch alles halb so wild, man gewöhnt sich daran. Ideen und Ergebnisse zu verwerfen, wird zum normalen Teil der eigenen Arbeit. Zudem lassen sich die Darlings gut in einer Schublade parken. Vielleicht machen sie sich ja gut in einem späteren Projekt.
Also, das Narrativ, sich mit Leidenschaft, Herzblut und persönlicher Begeisterung in jedes Projekt zu stürzen, klingt hübsch und verfängt bei vielen auch nur all zu leicht. Es sagt aber nichts über die fachlich-professionellen Kompetenzen von Projektpartner*innen aus.
Referenzen! Referenzen! Referenzen!
Referenzen sind handfeste Belege bzw. Beispiele dafür, was Kreative bzw. Freelancer*innen bisher in ihrem beruflichen Leben geleistet haben. Fehlt auf der Website eine Referenzliste, heißt das im Grunde nichts anderes, als dass es auch noch keine Projekte oder erbrachten Leistungen gibt. Gleiches gilt für „Pseudo-Referenzen“ wie die folgenden:
- Strategische Kommunikationsberatung für Großstiftung
- Imagebroschüre für eine Non-Profit-Einrichtung
- Namens- und Claim-Entwicklung für Startup
- Jahresmagazin für führendes Unternehmen aus der Modebranche
- usw.
Solche Aufzählungen sind keine Referenzen. Abgesehen davon, dass sie frei erfunden sein könnten, vermitteln sie weder einen Eindruck von der Art noch von der Qualität der (vermeintlich) erbrachten Leistungen. Referenzen sollten konkret beschrieben und benannt sein. Sonst haben sie wenig bis gar keinen Wert. In meinen Referenzen nenne ich z. B. immer den auftraggebenden Kunden sowie Art und Umfang der Leistung. Dazu kommt ein bildhafter Beleg der erstellten Magazine, Bücher oder Artikel. Bestenfalls gibt es noch eine direkte Download-Möglichkeit bzw. einen Link zur Publikation oder zur Kundenseite.
Natürlich gibt es Fälle, in denen sich einzelne (!) Leistungen auf der Website nicht konkretisieren oder darstellen lassen. Bei Autor*innen sind das z. B. Ghostwriting-Tätigkeiten. Spätestens beim direkten Kontakt mit einem interessierten Neukunden lassen sich diese jedoch belegen. Direkt weiterklicken sollten Sie bei Aussagen wie: „Mein Erfolg basiert auf dem persönlichen Vertrauensverhältnis zu meinen Kunden. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich aus diesem Grund hier keine konkreten Leistungen und Kundennamen nenne.“ (Originalzitat). Mit Verlaub, aber das ist Blödsinn, erst recht in der Kommunikation. Freischaffende leben davon, dass sie ihre Arbeit darstellen und belegen können. Das ist ihre Existenzgrundlage.
Echte Kundenstimmen oder Fake Feedback?
Was für Referenzen gilt, gilt natürlich auch für Kundenstimmen: Es zählen nur die echten. Und die Echtheit der folgenden Stimmen darf zu Recht bezweifelt werden:
„Wie immer eine super Zusammenarbeit! Herzlich Dank für die professionelle und schnelle Unterstützung“ – Hubert K., Programmdirektor eines internationalen Sozialverbands.
„Ich weiß nicht, wie wir es ohne Sie wieder geschafft hätten. Ihre Beratung ist Gold wert.“ – Susanne L., Projektmanagerin einer Stiftung.
„Das Magazin ist durch Ihren treffsicheren Stil und Ihre wissenschaftliche Kompetenz ein wahres Meisterwerk geworden.“ – Dirk F., Leiter eines Forschungsinstituts.
Wir kennen diese Form des Kunden-Feedbacks von Amazon & Co. Weder Aussagen noch Echtheit der Kund*innen lassen sich verifizieren. Dabei haben Auftraggeber*innen in der Regel nichts dagegen, wenn man nach erfolgreicher Zusammenarbeit ihr Lob auf der eigenen Website wiedergibt.
Eine etwas abgewandelte Form gefakter Kunden-Feedbacks findet sich in den Sozialen Medien bzw. Netzwerken. Sie dienen dort nicht nur als vermeintliche Referenz, sondern auch der eigenen Profilbildung:
„Heute von einem Kunden für meine strategische Kommunikationsberatung gelobt worden. Hat mich besonders gefreut, da es der Vorstand eines DAX-Konzerns war. 📈“
„Kundin bucht gleich alle Kommunikationsmodule für ein Jahr, weil sie so viel Gutes über mich gehört hat. Glückstag! 🍀“
„So viele Neukunden-Anfragen. Ich hoffe, ich schaffe es diesen Sommer noch in den Urlaub. ⛵️⛱“
„Gleich Meeting mit Kunden, der mich schon seit Jahren bucht. Kaffee läuft. ☕️“
Auffällig ist, dass hier eigentlich immer die Gleichen regelmäßig aus ihrem beruflichen Nähkästchen plaudern. Zumindest vermeintlich. Denn schaut man auf die Websites, ist von den zitierten Kunden häufig nichts zu sehen. Das Bild, das hier in den Sozialen Medien nach außen aufgebaut wird, ist das der super nachgefragten, hochkompetenten und erfolgreichen Freelancer*in. Inhaltlich wird es aber niemals konkret – aus Vertraulichkeitsgründen, versteht sich. Bei Twitter & Co. laufen solche Beiträge unter dem Namen „Geschichten aus dem Paulaner-Biergarten“. Denn nach dem dritten Weißbier werden die Geschichten immer abenteuerlicher …
If you pay peanuts, you get monkeys
Auch die Gestaltung der eigenen Website ist ein guter Maßstab für die Professionalität von Kreativen und Freelancer*innen. Mit Hilfe günstiger Stock-Fotos und WordPress-Vorlagen lassen sich heute schon in kürzester Zeit optisch ansprechende Webseiten gestalten bzw. beauftragen. Optimalerweise spiegeln sie die berufliche Richtung und Persönlichkeit der Freelancer*innen wider und sind nicht einfach nur stylish. Auf den Punkt sollten dann auch die Webtexte sein – sowohl inhaltlich als auch in Sachen Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung. Gerade bei Kommunikator*innen geht es hier um Kernkompetenzen und Glaubwürdigkeit. Folgende Beispiele stammen von der Website einer Kommunikatorin, die im Rahmen eines dreitägigen Kongresses von einer Hamburger Hochschule für ein Wissenschaftskommunikations-Seminar gebucht wurde.
Rechtschreibfehler bis in die Überschriften und Menüs hinein hätten zusammen mit den sprachlich-stilistischen Mängel eigentlich schon ausreichen müssen, um die Kompetenz der „Expertin“ zumindest zu hinterfragen. Hinzu kommen aber noch inhaltsleere Aussagen und floskelhafte Versatzstücke zum Thema Kommunikation. Ein Blick auf den beruflichen Werdegang und die Referenzen der Dozentin ergab dann auch keinen Hinweis darauf, wie und wo sie berufliche Erfahrungen in der Wissenschaftskommunikation gesammelt haben könnte. Ergebnis: Sie bekommen immer das, wofür sie bezahlen.
Ähnliches zeigte sich auch bei einem Online-Seminar des Deutschen Journalistenverbandes zum Thema „Online-Moderation“. Hier ging es um Stimme, Präsenz und technische Ausstattung bei der Moderation von Online-Seminaren und -Workshops – also im Grunde um das Gesamtpaket einer Online-Präsentation. Teilnehmende waren ausschließlich Journalistinnen und Journalisten. Die Dozentin war eine gelernte Sprecherin und Moderatorin. Als Online-Seminar war die Veranstaltung natürlich eine „gelebte Referenz“ für die Dozentin. Sie sprach über genau das, was sie im gleichen Moment praktizierte. Und eigentlich war inhaltlich-fachlich auch alles okay. Bis auf den kleinen Umstand, dass sie das, was sie in der dreistündigen Veranstaltung erzählte, als Text genau so auf ihren Folien stehen hatte und wortgetreu ablas.
Ein Kardinalfehler, wenn es um PowerPoint-Präsentationen geht. Dass aber selbst eine gelernte Moderatorin nicht frei spricht, kratzt dann doch am professionellen Image und untergräbt ihre fachliche Street Credibility. Zumal der journalistischen Zielgruppe auch die Schreib- und Ausdrucksfehler auf den Folien nicht entgingen. Wie schon gesagt: If you pay peanuts, you get monkeys.
Auf Kernkompetenzen achten
Kommunikation ist ein weites Feld. Ich zum Beispiel bin als Autor und Berater spezialisiert auf Stiftungs- und Wissenschaftskommunikation und würde niemals ein Film- oder Social-Media-Projekt annehmen – zumindest nicht, wenn ich keine entsprechenden Expert*innen mit an Bord hätte. Ein Buchautor kann auch nicht mal eben die Arbeit einer Zeitungsjournalistin übernehmen. Schreiben ist nicht gleich Schreiben und Kommunikation ist nicht gleich Kommunikation. Achten Sie also darauf, wo die Kernkompetenzen potenzieller Projektpartner*innen liegen. Sonst kommt es zum Desaster, wie es eine Hamburger Bank an einem ihrer jährlichen Stiftungstage erleben musste.
Da nämlich sprach im großen Festsaal des Hotels Atlantic ein Dozent aus Berlin zum Thema Stiftungskommunikation. Es war die bestbesuchte Veranstaltung des Tages. Der Saal war voller Stifter*innen und Expert*innen aus dem deutschen Bank- und Stiftungsbereich. Auf der Bühne stand ein junger Mann, Mitte/Ende 20, mit journalistischer Ausbildung, aber ohne jede praktische Erfahrung in der Stiftungskommunikation (wie ein Blick auf seine Website schnell bestätigte). Da ich die eingängige Literatur kannte, wusste ich, aus welchem Buch er seinen Vortrag zusammengeschrieben hatte. Und so begann dieser auch nach Lehrbuch: mit einer Einführung ins Stiftungswesen vor einem Saal voller Stiftungsexpert*innen. Kurzum: Es war eine Katastrophe.
Offensichtlich hatte der Dozent auch noch vor keinem vergleichbaren Publikum gestanden. Sein Vortrag war unsicher und stockend. Inhaltlich konnte er sich keinen Zentimeter rechts und links seines Textes bewegen. Als er sich dann – nach qualvollen 45 Minuten – bis zum Ende durchgekämpft hatte und erleichtert verkündete, nun dürfe man ihm Fragen stellen, ging nicht eine Hand nach oben. Stattdessen leerte sich der Saal in Sekunden. Das sind Erfahrungen, die man als Auftraggeber:in nicht machen möchte und auch nicht machen muss.
Es muss auch nicht immer gleich eine Katastrophe vor Publikum sein. Der Schaden ist bereits da, wenn externe Partner*innen in einem Projekt mit mehreren Beteiligten nicht das leisten (können), was sie zugesichert haben – sei es bei einer Publikation, der Entwicklung eines Social-Media-Auftritts oder bei einem Filmprojekt. Der Versuch nachzubessern, macht es häufig noch schlimmer. Besser ist es, die Person direkt auszutauschen. Das kostet natürlich zusätzliche Zeit und zusätzliches Geld. Schließlich muss jemand gefunden werden, der kurzfristig übernimmt und der in einigen Punkten auch noch mal von vorne anfängt.
So weit muss es aber gar nicht erst kommen. Entscheidend ist, die richtigen Kriterien bei der Auswahl der Projektpartner*innen anzusetzen – also fachliche. Und dazu gehört nicht, dass irgendjemand irgendjemanden Nettes kennt, mit dem er/sie sich auf den Fachkonferenzen immer total gut verstanden hat. Oder dass man da einen hat, mit dem man schon seit fünf Jahren auf Twitter „vertweetet“ ist. Ohne Frage, das Menschliche ist ein wichtiger Aspekt in der Projektarbeit, besonders wenn Projekte über längere Zeit laufen. Es sagt aber nichts über berufliche Kompetenzen aus.
Was zählt, sind Fakten – keine blumigen Worte
Zu viel Klüngel und persönliche Nähe trüben sogar den Blick auf die fachliche Seite. Im Projekt selbst verhindern sie häufig die notwendige Kritik – schließlich kennt man sich schon lange und versteht sich doch auch so gut. Doch niemand hat sich hier zum Kuscheln oder Kaffeetrinken verabredet. Es geht um eine professionelle Zusammenarbeit mit fest gesteckten Verantwortlichkeiten und Zielen, die man bestmöglich gemeinsam erreichen möchte. Das aber gelingt nur, wenn die fachlich passenden und kompetenten Partner*innen an Bord sind.
Deswegen hier die wichtigsten Punkte noch einmal zusammengefasst: Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Projektpartner*innen zuallererst auf Fakten wie
- klar belegte und illustrierte Referenzen,
- konkret benannte Kunden und Kundenmeinungen,
- Transparenz beim beruflichen Werdegang,
- nachgewiesene Erfahrung in dem von Ihnen gewünschten Leistungsbereich.
Das ist die Pflicht. Dann kommt die Kür. Zu dieser zählen der professionelle Gesamteindruck, die individuelle Persönlichkeit (also der Mensch), die Stimmigkeit und Kohärenz von Aussagen und beruflicher Tätigkeit und – last but not least – das gute alte Bauchgefühl.